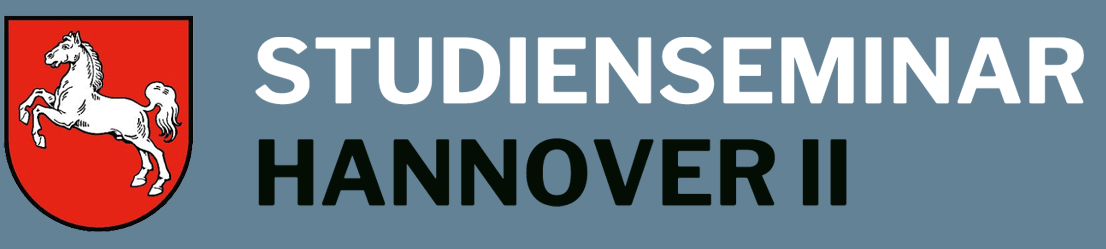Startseite » Seminar II
Archiv der Kategorie: Seminar II
Latein
Die Ausbildung im Fachseminar Latein am Studienseminar Hannover II wird betreut von: Fabian Egermann (StD) Die regelmäßigen Fachsitzungen finden statt am: Donnerstag, geradzahlige Kalenderwochen, Kernzeit: 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr. Die wesentlichen Anstrengungen einer Lateinlehrkraft sollten dem Ziele verhaftet sein, ihre Schüler*innen durch eine fachlich korrekte, didaktisch wie methodisch kompetente, pädagogisch schüleraktivierende und abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung […]
Erdkunde II
Willkommen bei den Geograph*innen! Am Studienseminar Hannover II wird die Ausbildung im Fach Erdkunde betreut von Daniel Behrens Fachsitzung: mittwochs (gerade Wochen), 15.00 – 18.00 Uhr Erdkunde als Unterrichtsfach Erdkunde ist ein Brückenfach, denn es verknüpft naturwissenschaftliche und gesellschaftswissenschaftliche Inhalte und Betrachtungsweisen miteinander. Damit leistet das Unterrichtsfach einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis von komplexen Phänomenen […]
Fachseminar Griechisch
Am Studienseminar Hannover II wird die Ausbildung im Fachseminar Griechisch betreut von: Stefan Gieseke (StD, Fachberater im Fach Griechisch, RLSB Hannover) Die Fachseminarsitzung findet nach Absprache alle zwei Wochen am Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium statt. Die Ausbildung im Fach Griechisch orientiert sich an der APVO-Lehr II und ihrer fachspezifischen Konkretisierung insbesondere für den Kompetenzbereich „Unterrichten“. Vorrangiger […]
Musik II
Informationen der Ausbildung im Fach Musik des Seminars II.
Sport II
Die Ausbildung im Fach Sport am StS Hannover II (LA Gym) wird betreut durch: Ulrich Görtemöller (StD) Termin der regelmäßigen Fachsitzungen: montags, geradzahlige Kalenderwochen, 15:30 – 18:30 Uhr. Abweichende Termine für Sonderfachsitzungen werden rechtzeitig bekanntgegeben, diese können auch an Freitagnachmittagen liegen. Zur Referendarausbildung im Fach Sport 1. Ausbildungsziel (in technologischer Hinsicht) Neben den grundsätzlichen Ausbildungszielen […]
Politik II
Informationen der Ausbildung im Fach Politik des Seminars II.
Physik II
Informationen der Ausbildung im Fach Physik des Seminars II.
Kunst II
Informationen der Ausbildung im Fach Kunst des Seminars II.
Französisch II
Am Studienseminar Hannover II wird die Ausbildung im Fach Französisch betreut von: Kristina Bonas, Fachleiterin Französisch Fachsitzung: montags, ungerade Wochen, 15.00 – 18.00 Uhr Die zweite Ausbildungsphase im Fach Französisch am Studienseminar II hat zum Ziel, die Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst (LiV) zu befähigen, einen modernen kommunikativen Französischunterricht erteilen zu können. Auf der […]
Englisch II
[Begrüßung] [namentliche Vorstellung der Leiterinnen und Leiter] [Verweise auf einführende Dokumente, z.B. Literaturliste, Spiralcurriculum, …] [evtl. Verweise auf nline-Dokumente] [evtl. aktuelle Informationen]