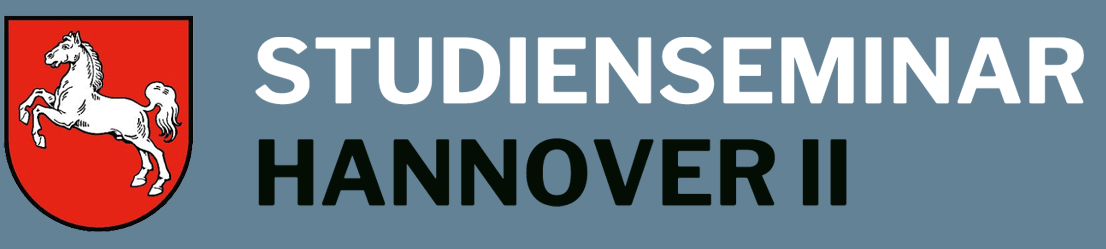Startseite » Seminar I
Archiv der Kategorie: Seminar I
Französisch I
Die zweite Ausbildungsphase im Fach Französisch am Studienseminar I hat zum Ziel, die Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst (LiV) zu befähigen, einen modernen kommunikativen Französischunterricht erteilen zu können. Auf der Grundlage der Kompetenzen, die die LiV während ihres Studiums erworben haben, wird in den 18 Monaten kontinuierlich und progressiv an der Erweiterung vorhandener und dem […]
Musik I
Informationen der Ausbildung im Fach Musik des Seminars I.
Mathematik I
Informationen der Ausbildung im Fach Mathematik des Seminars I.
Geschichte I
Ein guter Geschichtslehrer sollte Schüler für sein Fach motivieren und sie zum historischen Denken veranlassen können. Allerdings darf historisches Denken nicht als Selbstzweck fungieren, schließlich sollen aus den Heranwachsenden keine Geschichtswissenschaftler, sondern demokratisch gefestigte und selbstständig handelnde Menschen werden, die sich ihrer historisch bedingten Identität bewusst sind. An diesen Zielen trägt guter Geschichtsunterricht Anteil und […]
Englisch I
Informationen der Ausbildung im Fach Englisch des Seminars I.
Darstellendes Spiel
DAS FACH DARSTELLENDES SPIEL BIETET FREIRAUM Ihn als Moderator für theaterästhetische Prozesse intensiv nutzen zu lernen, ist ein wesentliches Ziel der Ausbildung Worin liegt das Besondere des Faches? Das Fach Darstellendes Spiel – das eigentlich besser Theater genannt werden sollte – gehört im schulischen Bildungskontext zu den Fächern mit dem größten Freiraum, was Inhalte, Formen, […]
Chemie I
Informationen der Ausbildung im Fach Chemie des Seminars I.
Evangelische Religion
Fachausbildung Evangelische Religion am Studienseminar Hannover I Der Religionsunterricht leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum schulischen Bildungsauftrag! Religiöse Bildung ist die Fähigkeit und Weiterentwicklung des (selbst-)reflexiven Umgangs mit religiösen Inhalten auf der Basis grundlegender Kenntnisse besonders der eigenen, aber auch anderer Religionen und Weltanschauungen. In dieser Perspektive ist es das zentrale Anliegen des Religionsunterrichts, die religiöse […]
Deutsch I
Deutschausbildung am Studienseminar Hannover I Das Unterrichtsfach Deutsch leistet einen wesentlichen Beitrag zur literarischen, sprachlichen und medialen Bildung von Schülerinnen und Schülern. Deutschunterricht bietet Lernenden in einem umfassenden Lern- und Bildungsprozess die Möglichkeit, Literatur, Sprache und mediale Produkte als gestaltete und gestaltbare Mittel der Selbst- und Welterfassung, der Interaktion und der Reflexion zu erfahren und […]